Die Country-Connection

Das schöne Leben – es findet in den Städten statt. Dort, wo alle wohnen wollen. Weil Metropolen den Menschen eben mehr Möglichkeiten bieten. Trotzdem wird die Zukunft auf dem Land entschieden. Denn unsere coolen Citys brauchen die bäuerliche Produktion, die Felder, Wiesen und Wälder – zur Versorgung und Erholung. Im Gegenzug sind rurale Räume mehr denn je auf urbane Impulse angewiesen, auf Verbundenheit. Stadt und Land müssen zusammenwachsen. Es lebe die grüne Nachbarschaftsliebe!
Kleine, bunte Blümchen sprießen – auf städtischen Balkonen, in Hinterhöfen und den Baumaussparungen der Gehwege. Improvisierte Beete engagierter Großstädter: ein Ausdruck von Sehnsucht nach mehr Natur. Wir wollen raus und doch drin bleiben, wollen jene ferne Idylle in unsere Städte holen. Eine Vision, die nur in eine Richtung zu funktionieren scheint – und trotzdem rückwärts gedacht werden kann.
Der Traum vom Fliehen
Zunächst einmal vorwärts: Wer in der Stadt wohnt, träumt vom Land, wird aber nur selten rausziehen. Doch zieht es schon lange immer mehr Landbewohner in die Stadt – obwohl sie gar nicht davon träumen. Denn Menschen werden nicht zu Metropoliten, weil sie Lärm und Verkehr so toll finden, sondern, weil sie in der City bessere Chancen haben: neue Jobs, gute Infrastruktur, viele Freizeitmöglichkeiten. Aber ist das alles? Führen sich die Menschen damit nicht selbst an der Nase herum?
Die Vision des Verbindens
Und jetzt rückwärts, denn für diesen Widerspruch gibt es eine einfache Lösung: Wir müssen die Städte einfach stärker mit dem Land verbinden. Vielleicht so stark, dass es irgendwann egal ist, ob ich im urbanen Zentrum oder 100 Kilometer entfernt am See wohne. Eine Vision ist das – von grüneren, ruhigeren, großzügigeren Städten auf der einen Seite und gut angebundenen, kulturell vielfältigen Landregionen auf der anderen. Was wir dafür tun müssen? Eine ganze Menge. Das Tolle daran ist aber: Wir haben bereits begonnen.
Wachsende Stadt für gedeihendes Land
Berlin als perspektivisches Beispiel: Die Stadt ist eine kulturelle Oase, wächst rasant, wird immer voller. Gleichwohl wachsen mit ihr auch Bedürfnisse, welche dem Brandenburger Umland in seine grünen Karten spielen. Denn das städtische Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge ist groß, noch größer daher der Bedarf an biologisch erzeugten Lebensmitteln aus der Region. Und so haben wir vor den Toren der Stadt mittlerweile eine der höchsten Dichten an ökologisch bewirtschafteten Flächen von ganz Deutschland. Das tut der Natur gut, fördert reflektiertes Denken auf dem Land und macht mit seinem Narrativ das ländliche Leben auch irgendwie sexy für die Städter.
Vom Ausflug zum Umzug
Kein Wunder, dass im Speckgürtel solidarische Landwirtschaftsprojekte entstehen, dass man seinen Ausflug an den See gern mit einem Besuch auf dem Ökodorf verbindet. Immerhin wollen bewusste Berliner wissen, warum diese oder jene Milch so gut schmeckt, ob man den Spargel wachsen hören kann und woher das reinste Wasser der Region kommt. Manche kaufen sich da draußen sogar eine Datsche. Und einige Datschianer verlieben sich so ins Ländliche, dass die am Ende der Großstadt doch den Rücken kehren.
Nicht abgekoppelt, aber abgehängt
Nichtsdestotrotz ist Brandenburg – wie die meisten ruralen Gebiete in den östlichen Bundesländern – nach wie vor strukturschwach. Auch hier marschieren zunehmend reaktionäre Kräfte in die Parlamente; gewählt von Menschen, die Angst haben, abgehängt zu sein, die Welt nicht mehr verstehen – oder einfach zu wenig von ihr gesehen haben. Denn die Welt dreht sich konzentrisch, nach wie vor. In der Stadt also die Gewinner, draußen die Verlierer? Längst nicht immer, aber ein bisschen ist es so. Nicht nur bei uns, sondern in den meisten Regionen und Ländern der Erde. Ein unfaires Spiel.
Fluch der Landflucht
Diese Abwanderung – die Urbanisierung – begleitet uns schon seit ein paar Jahrhunderten. Mit dem Beginn der Industrialisierung fing das Leben an, vom Land in die Städte zu strömen. Ein effizienz- und kapitalgetriebenes Phänomen. Neu daran ist, dass es sich heute selbst verstärkt: Wenn draußen weniger Menschen wohnen, wird die infrastrukturelle Anbindung automatisch unwirtschaftlich, schließlich schwächer und das Land damit noch unattraktiver.
Einsamkeit macht misstrauisch
Weniger Angebote, weniger Menschen, weniger los. Paradoxerweise führt das nicht zum Aufleben der Natur, denn fallende Werte und fehlendes Engagement für die Region machen eine Rationalisierung der Landwirtschaft fast notwendig. Öde und Einsamkeit. Ein Fluch für jene, die bleiben. Diese Übriggebliebenen knattern dann mangels positiver Reize verbittert mit ihren Motorrädern an glyphosatverseuchten Feldern entlang, suchen Halt in altertümlichen Ritualen und wählen böse alte Männer mit komischen Frisuren. Überall.
Die Krise als Weg ins Grüne
So aber muss es nicht sein. Manchmal zeigen uns sogar große Missstände, dass Menschen nicht immer das Schlimmste draus machen, sondern einen besseren Weg wählen können. In Griechenland zum Beispiel stieg die Arbeitslosigkeit im Zuge der Krise so heftig an, dass ein städtisches Leben für viele unmöglich wurde. Perspektivlose junge Leute zogen in Scharen raus aufs Land, und fingen an, sich selbst zu versorgen, reaktivierten die brachliegenden Felder ihrer Großeltern. Manche schlossen sich zusammen und machten aus diesem neu-bäuerlichen Leben ein kleines Geschäft. So entstanden Start-ups, welche heute zu teils hippen Premium-Marken avanciert sind.
Digitale Landschaftsgärtner
Rein theoretisch ist es heute sogar attraktiver als vor ein paar Jahrzehnten, auf dem Land zu leben. Denn da wäre ja noch dieses digitale Netz! Nehmen wir mal an, es gäbe auch bei uns eine potente, flächendeckende Internetversorgung. Die dürfte doch ein Anlass sein, sich mit Stadt und Welt verbunden zu fühlen. Aber so wenig wie wir heute komplett analog sein können, so schwachsinnig wäre es auch, zu versuchen, sein ganzes Leben ins Digitale zu verlagern.
Das globalisierte Dorf
Das globale Dorf ist eine Chance, aber es braucht auch globalisierte Dörfer, um in Frieden zu gedeihen. Kleine Siedlungen, die nicht schwinden, sondern wachsen, ein analoges Netzwerk bilden, zur Stadt ohne Lärm und Zentrum werden. Solche Dörfer schafft man nicht allein mit Glasfaserkabeln und engagierten Cyber-Hippies, die versuchen, in der Einöde Craft-Bier zu brauen, wenngleich das durchaus ein Ansatz sein kann. Aber das Landleben der Zukunft braucht physische Verbindungen zur Stadt. Gute Infrastrukturen. Gemeinsame Projekte. Gekoppelte Bildung, Jobs und neue Perspektiven.
ÖPNV – genau!
All dies hängt an einem seidenen Faden: der Mobilität. Ein Grundbedürfnis. Sie bildet die Basis von Handel, Austausch, Entwicklung. Je selbstverständlicher, desto größer die Chancen. Ein Jugendlicher, der von seinem Dorf mit Bus und Bahn problemlos in die Stadt kommt – und auch nachts wieder zurück –, kann ein ganz anderes, vielfältigeres Leben führen. Eine alte Dame übrigens auch (ob sie nun raven geht oder in die Operette, ist dabei reine Geschmackssache). Wenn das möglich ist, werden Menschen viel eher aufs Land ziehen. Und mit mehr Menschen kommt auch das Leben zurück aufs Land.
Mut zur Häuserlücke
Kehren wir mal zu der Vision vom Anfang zurück! Angenommen, es gäbe mehr Beweglichkeit und die Leute würden sich mit den Möglichkeiten aufs Land bewegen. Dann nähme das Gedränge in der Stadt vielleicht sogar ab. Neue Lücken könnten entstehen. Lücken, die man nicht füllen muss, sondern begrünen kann oder einfach so lässt. Zentren würde sich fragmentieren und ausweiten, Perspektiven verschieben und vermischen, Preise entspannen.
Möglichkeit Metropolregion
Wie so etwas auf herkömmliche Art und Weise aussehen kann, zeigen historisch zergliederte Metropolregionen wie das Rheinland oder Ruhrgebiet. Sie sind gekennzeichnet von fließenden Übergängen. Ein weitmaschiges Netz an Siedlungen und Feldern, an Erholungs- und Inspirationsmöglichkeiten. Nicht sonderlich grün vielleicht, aber man kann es ja besser machen. Eine ideale Metropolregion Brandenburg oder Sachsen müsste weniger Straßen und mehr Schienen haben. Viel Natur, aber auch viele Möglichkeiten.
Wertschätzung und guter Wille
Mit viel gutem Willen, Interesse und Respekt können neue Brücken entstehen. Beziehungen, die das Bewusstsein stärken und Austausch in Schwung bringen. Das ist die beste Basis für mehr Bewegung und eine gute Infrastruktur. Es gilt allerdings auch, die politischen Rahmenbedingungen einzufordern, neoliberale Rationalisierungen rückgängig zu machen, das Land zu fördern und weiter aufzubauen. So, wie die städtische Mietpreissteigerung gestoppt werden muss, muss auch ländlicher Lebensraum geschaffen werden.
Stadt-Land-Kuss
Aus einer neuen Stadt-Land-Liebe kann die Kulturlandschaft von morgen entstehen – multipolar, multioptional, multikulturell. Heute ist es für die meisten hip, zur Erholung rauszufahren. Morgen aber könnte es viel hipper sein, draußen in der Erholung zu leben, zu arbeiten. In die Stadt würde man nur noch fahren, um das einzukaufen, was es vor der Haustür nicht gibt – oder für den besonderen Kulturkonsum. Und vielleicht wäre selbst das nicht mehr nötig, weil die Räume zusammengewachsen sind, sich mit mehr Natur und mehr Möglichkeiten gefüllt haben. Stadt gleich Land. Ein großer Traum, aber wir können alles dafür tun, dass er Wirklichkeit wird.









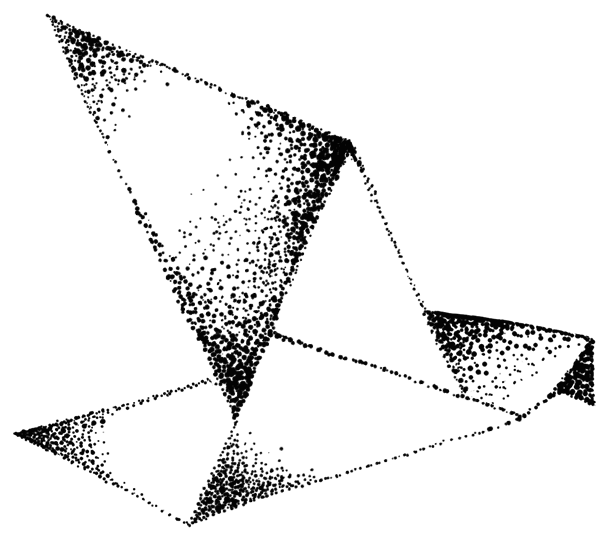
0 Kommentare