Aufeinander eingehen – miteinander weiter gehen

Ein paar Gedanken zum gesellschaftlichen Dialog am Beispiel der Landwirtschaft
Unsere Lebenswelt ist im Umbruch. Viele schlaue Leute haben viele tolle Ideen für eine bessere Zukunft. Und was passiert? Recht wenig. Weil wir im großen Ganzen gegeneinander und nicht mehr füreinander agieren – jeder in seiner sozialen Blase. Dabei war da doch mal die Idee von der Synthese: die, dass Fortschritt nicht nur Ideale und Argumente braucht, sondern fruchtvollen Dialog. Aber wie bringt man beides zusammen? Eine Auseinandersetzung mit dem guten Willen.
Auftritt der Gladiatoren: Ökologische Landwirtschaft vs. Bauernverband, Industrie vs. Klimaschützer, G8 vs. Globalisierungsgegner, Europäische Idealisten vs. Nationalkonservative, Internetkonzerne vs. Datenschützer, Postkapitalisten vs. Neoliberale et cetera. Unser öffentlicher Diskurs ist voller Gegensätze.
Eigentlich nicht schlimm, sondern eine Chance für neue Wege, zur Vermittlung und Entwicklung. Nur, dass daraus Zwietracht statt Pluralismus wächst. Alle duschen sich in ihren Filterblasen ausgiebig unter der eigenen Meinung, werden kaum mobiler, dafür aber lauter. Sie wettern gegen andere, ohne dabei sinnvoll auf ihre designierten Feinde einwirken zu können. Ein verbitterter Kampf um Vorherrschaft.
Wer weiß schon, wie es sich anfühlt, anders zu ticken, als man selbst?
Im Netz verschärft sich die Sprache. Sie ist bereits Gewalt. Und jede Gewalt zielt am Ende auf den Körper ab. Psychosomatik und so: Rede und Gegenrede als Waffen, die krank machen. Krieg (ob psychisch oder physisch) dürfen wir aber eben nicht als das berühmte andere Mittel zur Fortsetzung der Diplomatie begreifen. Vielmehr ist er Ausdruck eigener Hilflosigkeit.
Da schreit man oder frau mit den besten Absichten: „Bin ich denn nicht auf der Seite der Besseren? Das müssen diese A********** doch begreifen!“ Müssen sie? Tun sie aber nicht. Und aus deren Perspektive sind wir selbst wahrscheinlich genau so absurde Aliens.
Ist es mein Verdienst, dass ich nicht auf der dunklen Seite stehe?
Wo wir uns zuhause fühlen, einordnen, aufstellen – ob wir eher progressiv oder revisionistisch unterwegs sind, das scheint vor allem eine Frage der Sozialisation zu sein. Umstände, in die man arbiträr hineingeboren wird, und die vielen Zufälle des Lebens, welche uns beim Ich-werden begegnen – oder auch nicht –, prägen das Weltbild jeder*s einzelnen massiv. So ist unsere Meinung letzten Endes wohl weniger Verdienst der eigenen Anstrengungen, sondern eher ein launischer Begleiter derselben. Und trotzdem glauben wir fest an die Überlegenheit des eigenen ideologischen Gartens, welchen wir hegen, pflegen, aber nur allzu selten verlassen.
Sind wir besser, weil wir weiter denken?
Wer geht denn raus und redet mit denen, die so ganz anders sind, als man oder frau es selbst ist? Viel einfacher und angenehmer läuft der engagierte Beitrag zum Diskurs, wenn wir Gleichgesinnten uns gegenseitig mit weisen Worten einbalsamieren, welche die gemeinsame Weltsicht widerspiegeln.
Die Haut wird glatt und jung und wunderschön flexibel; nur da im Kopfe wachsen rücksichtsvoll elaborierte Feinstrukturen – wachsen fest. Unsere Worte verklingen in den eigenen Ohren oder werden – mit allerlei geistigem Sprengstoff bewährt – aus der ordentlich gestutzten Hecke freundlich aufs Gefechtsfeld abgefeuert.
Wie wäre es mit Der-Klügere-fragt-nach?
Sich selbst zurückzunehmen und in leiser, kompromissbereiter Art mit den eher abwegigen Gestalten zu debattieren – darauf hat zwar niemand ernsthaft Bock. Doch Bock, den braucht es, um als Gesellschaft Sprünge zu machen, voranzukommen, Gipfel oder Täler zu überwinden.
Es braucht mehr als die Lust, das eigene Leben zu ändern oder sich über das sich nicht ändern wollende Leben der anderen aufzuregen. Nein, um etwas zu bewirken, können wir die Entwicklungsmöglichkeit nur als eine gemeinsame annehmen – auch wenn jene anderen so ziemlich alles wollen außer Entwicklung. Gerade dann. Wenngleich: bestimmt nicht um jeden Preis.
Sollte man dann wirklich mit allen sprechen?
Von einem verzweifelt gutmütigen Standpunkt aus auf unsere immer rauer werdende Welt geblickt heißt es ja, man solle auch den pöbeligsten Anhänger*innen „alternativer Fakten“ zuhören, mit ihnen ins Gespräch kommen, ihre „Ängste und Sorgen“ ernst nehmen. Muss man das immer? Ich finde nicht. Es gibt Grenzen.
So habe ich beispielsweise mal versucht, in langen Gesprächen mit einem Pegidisten Kompromisse zu erwirken. Freundlich. Ruhig. Und absolut erfolglos. Das Negativergebnis war dann der Link zu einem Hassartikel gegen weltoffene ‚Gutmenschen‘, den ich ein paar Tage später von ihm zugeschickt bekam (Tränen-lach-Smiley). Nein, man/frau muss nicht mit jedem reden, sollte es aber vielleicht mit mehr Menschen versuchen, als einem lieb ist.
Wer passt nicht an den runden Tisch – und doch so gut?
Es handelt sich ja auch nicht immer um rechtsradikale Trump-Adepten. Aber selbst und gerade wenn jemand eine völlig entgegengesetzte Meinung vertritt, dann ist diese in vielen Fällen selbstopportun, nicht bösartig. Von irgendeinem – wenn auch kruden – Standpunkt aus nachvollziehbar. Und das ist ein Ansatzpunkt des guten Willens. Es braucht nur etwas Empathie.
Ein paar Beispiele: Die meisten, selbst sehr krassen Kapitalist*innen wollen nicht unsere Welt zerstören oder Menschen quälen, sondern stehen einfach tierisch auf Kohle. Verteidiger*innen des Kohlezeitalters dagegen haben einfach tierische Angst vor Veränderung, weil sie dadurch gezwungen werden, sehr schnell sehr kreativ zu werden, um nicht alles zu verlieren. Und glyphosat-begeisterte Großbauer*innen finden es eben tierisch ungerecht, auf einmal als Buhmänner der Nation hingestellt zu werden, wo sie doch nur das machen, was früher eigentlich alle toll fanden.
Früher ist natürlich vorbei und Morgen vielleicht noch nicht da. Das weckt bei den Menschen Unsicherheit und Angst. Aber auch für Angststörungen gibt es wirkungsvolle Gesprächstherapien. Zum Beispiel den demokratischen Dialog. Fangen wir einfach mal damit an!
Beispiel Ökolandbau: Sind die Konventionellen unsere Gegner?
Als die konventionellen Bauern am 26. November 2019 halb Berlin mit ihren Treckern lahmlegten – aus Protest gegen neue Naturschutzauflagen – da fühlten sich die Befürworter einer Pestizid- und Gentechnik-geleiteten Landwirtschaftsindustrie von der Mehrheit der Produzenten bestätigt. Aber wenn man diesen zornigen Landwirten richtig zuhört, lässt sich vernehmen, dass denen die Umwelt gar nicht so egal ist. Sie sind vielmehr in eine selbst gestellte Falle getappt – gemeinsam mit der Politik: im weltweiten Preiskampf hat sich das industrielle Produzieren ad absurdum geführt – bis zu dem Punkt, an dem die meisten Bäuer*innen Probleme bekommen, von ihren Ertrgäen überhaupt noch leben zu können. Trotz extremer Effizienz. Oder gerade deswegen.
Dabei geht zuerst die Natur drauf, dann die Produktion, dann die Menschheit. In einer komplexen Welt ist es aber wenig hilfreich, mit dem Zeigefinger Schuldige auszumachen und alles von ihnen zu fordern. Es geht eher um Angebote. Die Ökoszene war eine Pionierin des gesellschaftlichen Wandels. Jetzt ist es an ihr, alle anderen mitzunehmen. Sehen wir die Konventionellen also nicht als Gegener, sondern als Opposition, mit der wir zusammenarbeiten müssen, um etwas zu erreichen. Demokratie statt Oligarchie.
Antithese – was wollen die Bauern eigentlich?
Georg Janßen von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft etwa gibt zu, dass es so nicht weitergehen kann. Deutschland krankt an mangelnder Wertschätzung – gegenüber Lebensmitteln, gegenüber der bäuerlichen Arbeit und nicht zuletzt gegenüber der Natur. Vielleicht würden sich die konventionellen Landwirte* gar nicht so sehr über striktere Regeln aufregen, wenn sie im Gegenzug mehr Geld für ihre Arbeit bekämen. Vielleicht wären viele von ihnen bereit, weitaus größere Schritte in Richtung Boden-, Gewässer- und Artenschutz zu gehen, wenn es für sie wirtschaftlich darstellbar wäre – und wenn sie mehr Anerkennung erführen.
Natürlich krankt die ganze Branche auch an der (nicht vorhandenen) Verteilungsgerechtigkeit von Fördergeldern. Laut Janßen bekommen 20 Prozent der Betriebe 80 Prozent der EU-Milliarden. Das sind meist die Großen. Denn Subventionen werden momentan noch pro Fläche vergeben. Schlecht für alle kleineren Erzeuger*innen (übrigens auch für die ökologischen).
These – was hat die Öko-Wirtschaft auf Tasche?
Um das ‚Vielleicht‘ noch weiter zu denken: Möglicherweise wären zahlreiche konventionelle Bauern* sogar bereit, auf kontrolliert biologischen Anbau umzustellen. Es gibt dafür immerhin gewichtigen Gründe. Zum Beispiel ist der wirtschaftliche Ertrag pro Fläche höher, weil in jedes Stück Land mehr gute Arbeit fließt. Deshalb müssen die Preise der Erzeugnisse zwangsläufig höher sein. Von der Fläche aus gesehen, bringt weniger dann also oft mehr für die Landwirte.
Sie müssen außerdem keine Chemie einkaufen und können auf die Kraft des gesunden Bodens setzen. So wird, wenn man es richtig macht, ihr Land auch für die nächste Generation noch fruchtbar sein. Zudem funktioniert das Miteinander anders: nicht nur mit der Natur zeigen wir uns solidarisch (und sie im Gegenzug mit uns), sondern auch untereinander. Wer wechseln will, wird Unterstützung erfahren. In Zusammenschlüssen wie dem Märkischen Wirtschaftsverbund sitzen Landwirte* und Abnehmer*innen an runden Tischen, um faire Preise zu verhandeln. „Lidl lohnt sich“ vielleicht für Verbraucher*innen (die nicht an morgen denken) – Bio dagegen für alle.
Synthese – gibt es einen Mittelweg?
Um zu skizzieren, wie ein kompromissvoller Weg aussehen könnte, möchte ich drei Lösungsansätze vorstellen, auf die sich konventionelle und ökologische Landwirtschaft wohl ganz gut einigen könnten:
1. Wer will, dass ein Kurswechsel in toto funktioniert, muss allumfassend denken. Sein eigenes Umdenken umdenken lassen. So kann man etwa Auflagen für die nationale Landwirtschaft nicht verschärfen, ohne von allen importierenden Herstellern Gleiches zu verlangen. Von wegen Konkurrenzfähigkeit.
2. Lebensmittel zu Dumpingpreisen sollten grundsätzlich der Vergangenheit angehören, notfalls durch politischen Beschluss. Besser aber wäre es, mehr Bewusstsein von den Verbrauchern* einzufordern. Niemand muss Fleisch zu fünf Euro pro Kilo kaufen. Das ist pervers. Für das Klima, für die Natur, für die Tiere und – ja – auch für die Bäuer*innen.
3. Natürlich müssen sich die Verbraucher*innen Lebensmittel weiterhin leisten können. Aber anstatt die Preise zu drücken, wäre es doch auch eine Möglichkeit, die Gehälter anzuheben – beispielsweise per Mindestlohn oder über das viel diskutierte Grundeinkommen.
Landwirtschaftstag – wie viel bringt so ein Austausch?
Sechs Tage vor der großen Bauerndemo – am 20. November 2019 – veranstaltete die Preussenquelle ihren 3. Landwirtschaftstag im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. Dabei ging es nicht um ein hermetisches Bessermachen innerhalb der Öko-Szene, sondern gerade um das Öffnen der eigenen Sphäre für ein Gespräch mit Externen.
Zahlreiche konventionelle Bauern* waren eingeladen – und kamen auch, um sich Vorträge über ökologischen Landbau und agrarpolitische Rahmensetzungen anzuhören; vor allem aber, um sich auszutauschen. Es waren gute Gespräche, die im Kleinen jedes Jahr einiges bewirken. Auf diese Art und Weise entsteht Verständnis füreinander und im Idealfall ein neues Miteinander.
Erwartungshaltung – wer ist das Maß aller Dinge?
Wir können natürlich nicht von jeder Bäuer*in, die sich für mehr Ökologie interessiert, erwarten, dass sie sofort auf Bio umstellt. Das ist eher ein langsamer Prozess des Kurswechsels, vielleicht auch nur ein Überprüfen des eigenen Wirtschaftens. Aber je mehr sich Verbraucher*innen und Erzeuger*innen, Öko-Avantgardisten* und Konventionelle austauschen, desto größer sind die Chancen, unsere Lebensmittelproduktion nachhaltig zu wandeln.
Und an diesem Punkt treffen sich viele Interessen. Akteuren wie dem Naturpark Stechlin-Ruppiner Land und dem Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land geht es um Naturschutz. Die Preussenquelle setzt sich für sauberes Wasser ein. Verbraucher*innen wollen gute, aber auch bezahlbare Lebensmittel. Bauern* haben vernünftige Arbeitsbedingungen, faire Entlohnung sowie eine Anerkennung ihrer Arbeit verdient.
Dies alles unter einen Hut zu bringen, scheint schwierig. Und doch zeigt sich der gute Wille aller im Dialog, wenn dieser zugelassen wird – mit Anstand und Respekt, ohne Voreingenommenheit und große Emotionen.
Wie wichtig sollte uns das, was wir erreichen wollen, sein – um es zu erreichen?
Natürlich braucht es manchmal klare Worte, um auf Missstände hinzuweisen. Aber in Verbindung mit einem kompromissbereiten Gesprächsangebot sind sie umso kraftvoller.
Solch ein demokratischer Dialog ist aufwendig. Angesichts der extremen Komplexität globaler Zusammenhänge scheint er mir aber die einzig sinnvolle Lösungsmöglichkeit unserer Riesenprobleme zu sein. Dabei wird nie jemand sein Ziel zu 100 % erreichen. Aber ist es nicht besser, 50 % der eigenen Überzeugungen zu vermitteln oder mit anderen Meinungen zu verheiraten, als gar nichts zu erreichen – außer Frustration?

Dialog, photography by Rudolf Bonvie, 1977, CC BY-SA 3.0
Lasst uns Gesprächspartner suchen, die wir nicht verstehen!
Ich bin kein Christ oder Anhänger irgendeiner bestimmten Religion, Lehre, Philosophie, Ideologie – nicht einmal Spezialist* für irgendetwas. Aber als Rosinenpicker finde ich, dass man sich durchaus gute Gedanken anderer Gerüste anschauen und sie vielleicht mit den Konstrukteuren* dieser fremden Gebäude weiterentwickeln kann. Sicherlich nicht mit allen. Aber es erscheint mir immer als etwas Bereicherndes, wenn ich durch unbekannte Welten surfe und in anfangs völlig unverständliche Ansichten abtauche – um nicht nur etwas offener, sondern manchmal auch in Begleitung neuer Freund*innen zurückzukehren.
Und so möchte ich alle ermuntern, das eigene Grundstück zu verlassen, um möglichst abwegige Gesprächspartner* aufzusuchen. Genau die, deren Leben ihr nicht so gut nachvollziehen könnt. Denn Fortschritt beginnt mit Verstehen.
*Anmerkung = Gendern ist aus linguistischer Sicht genauso schwierig wie nötig. In diesem Artikel habe ich verschiedene Möglichkeiten miteinander kombiniert (alle nicht vom Duden anerkannt!): mal die männliche, mal die weibliche Form, mal maskuline oder feminine Generika oder beide; stets mit einem Stern markiert. Es seien immer alle mitgemeint. Denn auch die sprachliche Welt ist in Entwicklung.






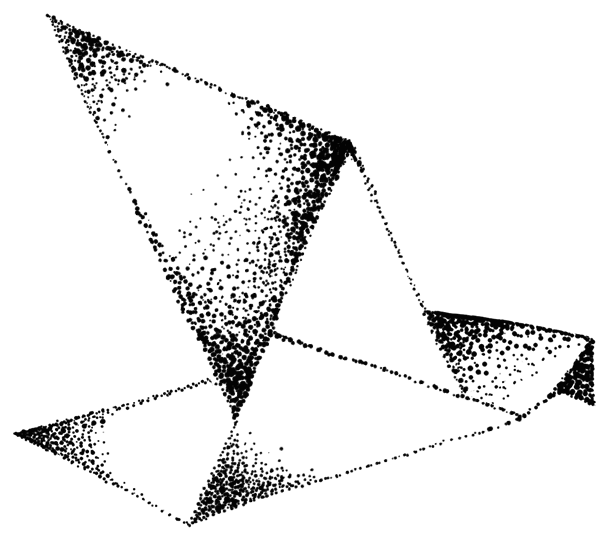
0 Kommentare